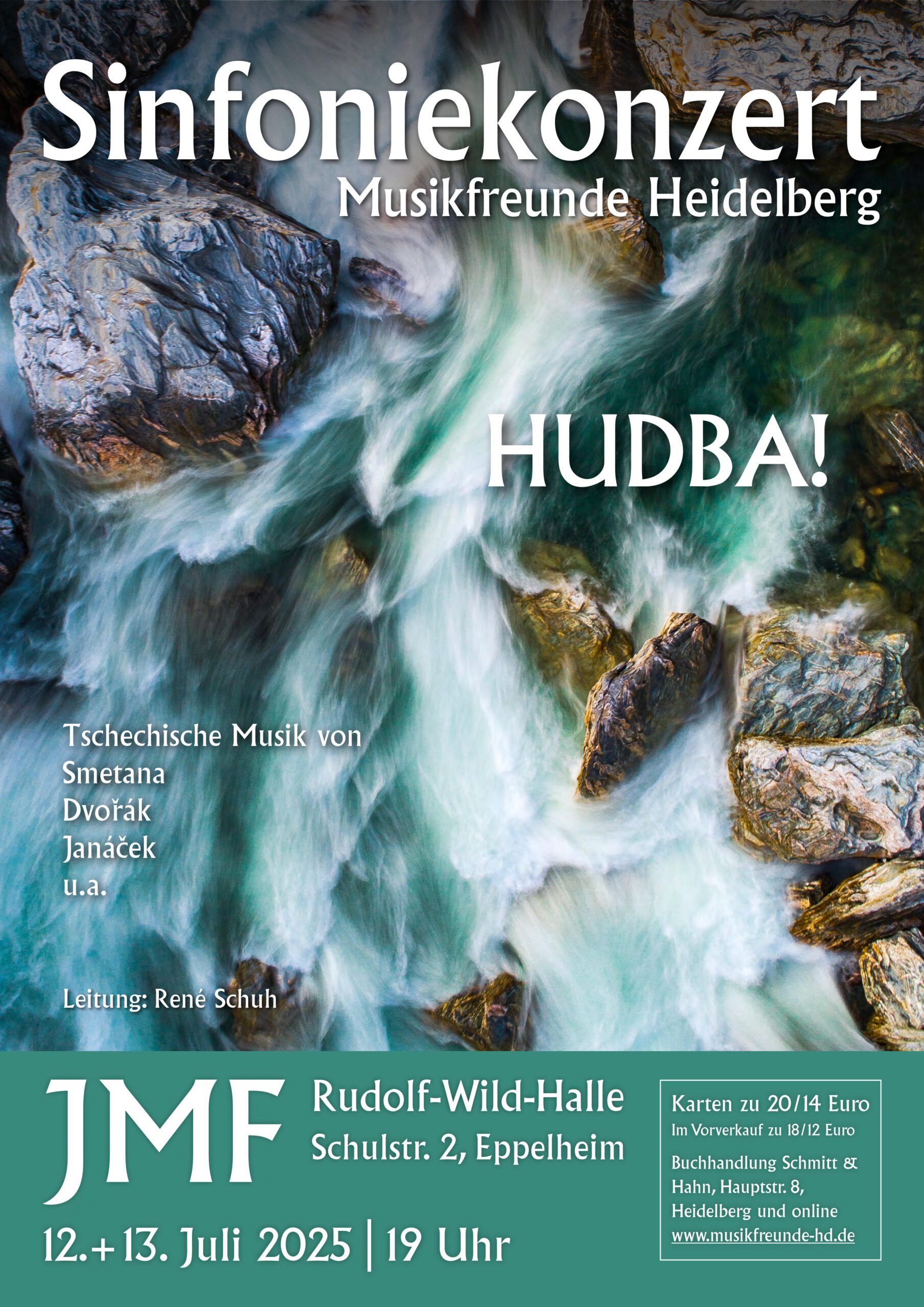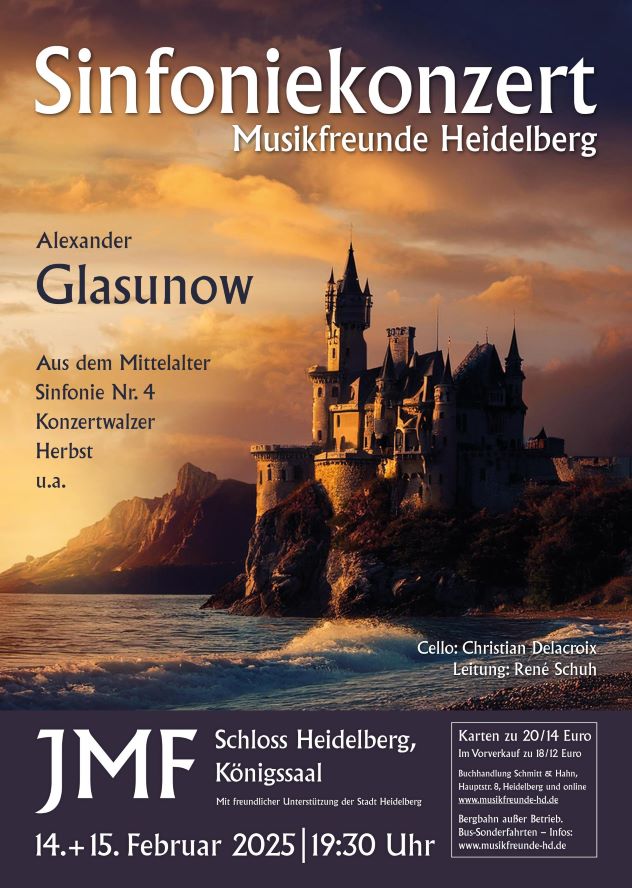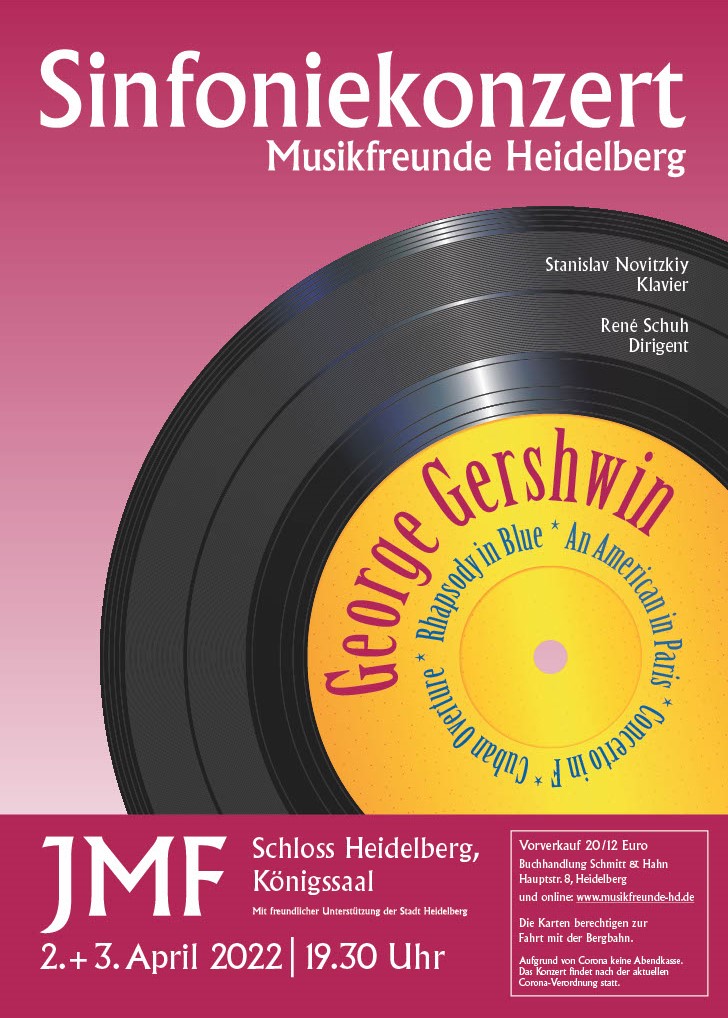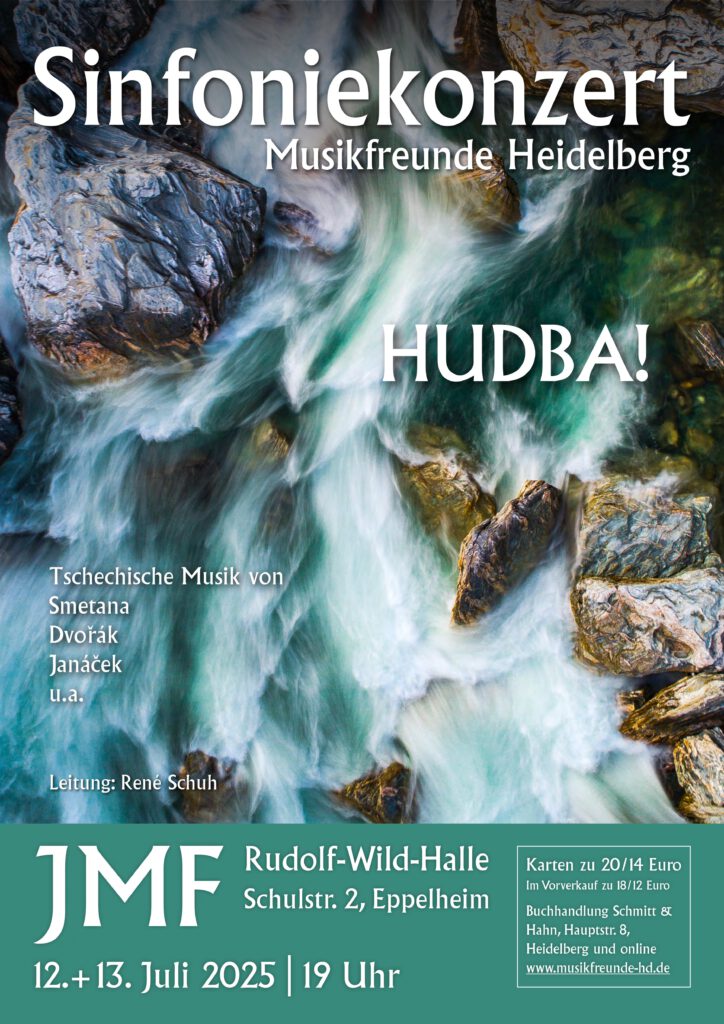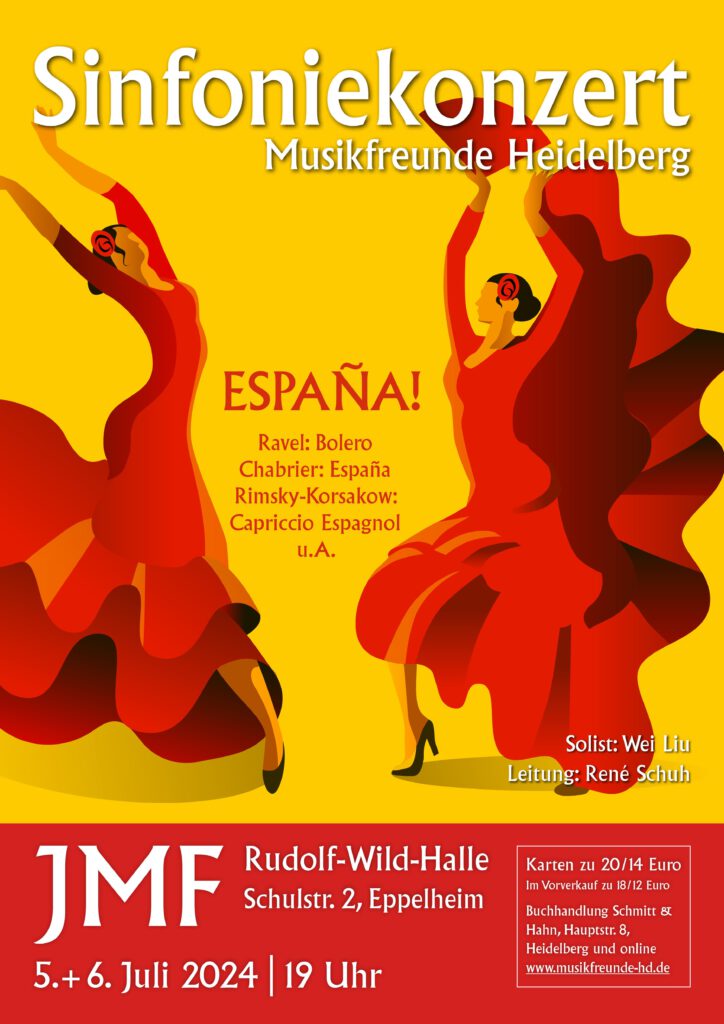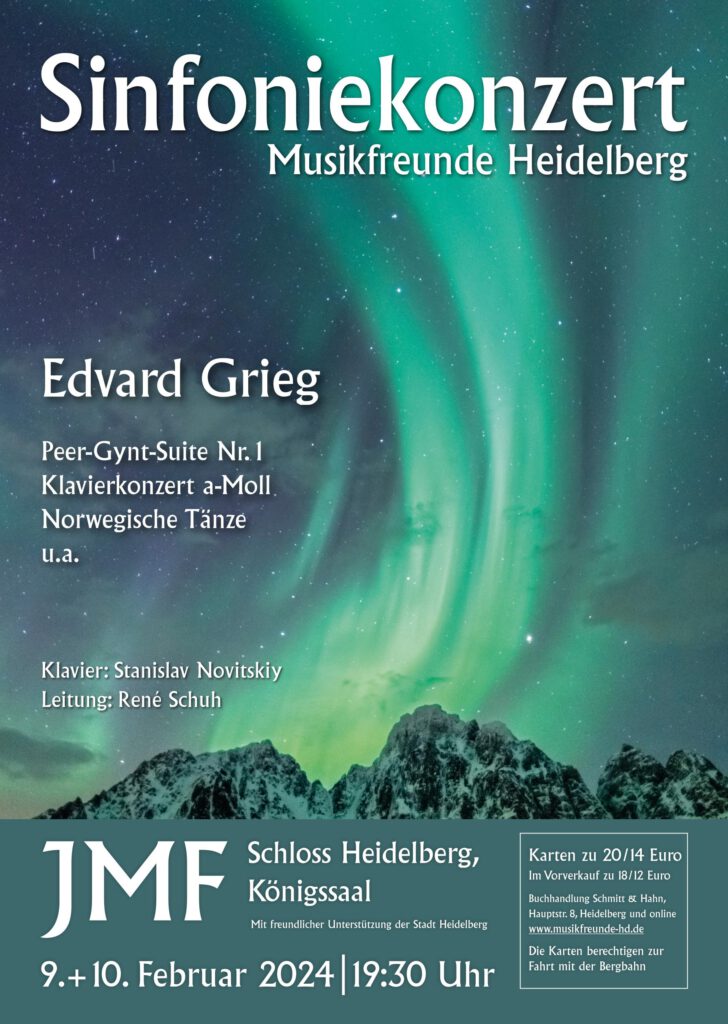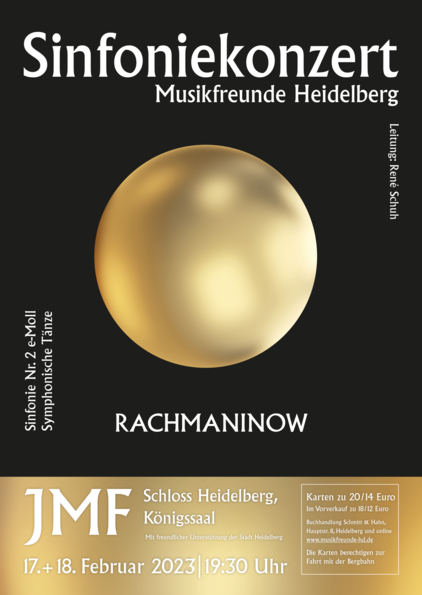Weitere vergangene Programme
Hudba! Tänzerisch aus Tschechien in die Welt
Die Moldau ist nur 430 Kilometer und als Musikstück etwa zwölf Minuten lang. Trotzdem ist sie weltberühmt. Das gilt auch…
Alexander Glasunow
Alexander Glasunow war ein Meister der raffinierten Orchestrierung. Noch erfreulicher für sein Publikum war und ist, dass seine Musik höchst…
España!
„España“ lautet der Titel der Rhapsody von Emmanuel Chabrier. Der wiederum gibt das Reiseland der Musikfreunde Heidelberg vor. Mit ihrem…
Sagenhafter Abend mit der Musik von Edvard Grieg
Die Musikfreunde Heidelberg entfesseln auf dem Schloss Trolle, Herbststürme und Springtänze.
Hungarica!
Wehmütig seufzen darf man beim Konzert der Musikfreunde Heidelberg gelegentlich auch. Doch das sind eher Pausen, bis das ungarisch-rumänische Programm…
Rachmaninow – ein Leben in sieben Sätzen
Furor, Liebreiz, Zerrissenheit und Harmonie – die Worte reichen nicht aus, was bei den Musikfreunden Heidelberg an Spätromantik zu hören…
Juni 22, 2025
Hudba! Tänzerisch aus Tschechien in die Welt
Februar 14, 2025
Alexander Glasunow
Juli 6, 2024
España!
Februar 12, 2024
Sagenhafter Abend mit der Musik von Edvard Grieg
Juli 9, 2023
Hungarica!
Februar 9, 2023
Rachmaninow – ein Leben in sieben Sätzen
Juli 6, 2022
All Inclusive – Das Beste aus 5 Reisejahren
April 2, 2022
Gershwin
Februar 10, 2020